Sprechen wir über die kulturellen Voraussetzungen historischer Errungenschaften wie die Menschenrechte, dann schliesst das die Frage ein, wie es um die religiösen Ressourcen bestellt ist, aus denen heraus sie selbst und damit eine Koexistenz mit anderen Glaubensformen begründet werden kann. Immer wieder sind Religionen, in deren Namen Menschen unterdrückt und verfolgt wurden, zuweilen selbst Gegenstand von Unterdrückung und Verfolgung geworden, was oft selbst dann noch in der kollektiven Erinnerung nachhallt, wenn die Glaubensgemeinschaft schon längst aus ihrer Minderheitenposition herausgetreten ist. Im Falle des Christentums sind es zunächst die spätantiken Verhältnisse gewesen, unter denen es Repression erfuhr, bevor es selbst repressiv wurde.
Auch im oströmischen Reich waren Christen anfangs nicht wohlgelitten, so unter Kaiser Julian (reg. 361-363), der ihnen den Lehrerberuf untersagte, weil sie sich weigerten, die homerischen Epen zu unterrichten. Welche Seite die intolerantere war, ist die Frage. Als vorherrschende Religion sollte das Christentum jedenfalls lange Zeit für Gewalt und Intoleranz stehen, auch wenn das christliche Byzanz mit der Sklaverei der Antike gebrochen hatte. Christen setzten sich am liebsten dort für Glaubensfreiheit ein, wo sie selbst in der Minderzahl waren. Seit der Bekehrung Kaiser Konstantins 312 und dem Aufstieg des Christentums bis zur Staatsreligion unter Theodosios, hatte sich diese Haltung gefestigt, die bis ins 19. Jahrhundert hinein anzutreffen sein sollte. Soweit es kultische Elemente betrifft, hatte das Christentum überall dort, wo es sich verbreitete, wenig Erbarmen mit anderen Religionen gezeigt. Das ältere Heidentum wurde auch nicht einfach abgelöst, sondern gewaltsam bekämpft und heidnische Tempel ebenso wie jüdische Synagogen zerstört. Auch der Lynchmord, dem die heidnische Philosophin Hypatia zum Opfer fiel, war religiös motiviert.
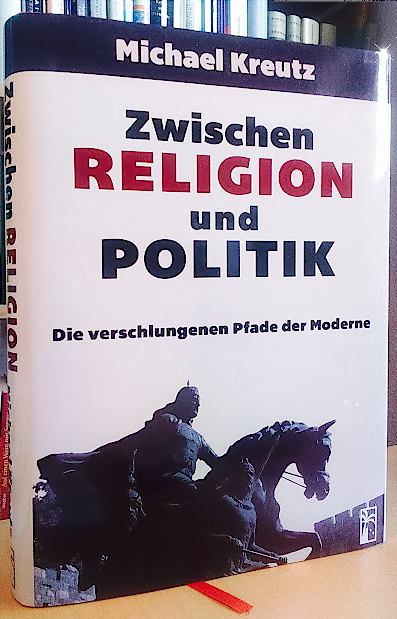
Der britische Historiker Edward Gibbon (1737-1793) hatte einst notiert, dass der Niedergang des Heidentums unter Theodosios im 4. Jahrhundert das vielleicht einzige Beispiel für die völlige Ausrottung eines bedeutenden antiken Glaubenssystems abgebe. Die Darstellung zahlreicher Arten von Gewaltszenen in byzantinischen Chroniken hat den Byzantinisten Herbert Hunger zu der lakonischen Feststellung veranlasst, dass sie reiches Material für eine eigene Brutalitätsforschung abgebe. Ausgerechnet die Religion der Liebe, resümiert der katholische Theologe Georg Baudler, „hinterließ die längste und breiteste Blutspur in der Geschichte der Weltreligionen.“
Gewalt und Unterdrückung schienen denn lange Zeit mit dem Christentum vereinbar. Als im 16. Jahrhundert im französischen Toulon die örtliche Kathedrale zu einer Moschee umfunktioniert wurde, geschah dies nicht als Hulderweis an die Adresse der Andersgläubigen, sondern diente auf pragmatische Weise der französischen Kooperation mit den Osmanen im Sklavenhandel. Letztere, von denen 30.000 in der Stadt wohnten, durften dazu den Hafen benutzen und in der Stadt einen Sklavenmarkt abhalten. Die aus dem Umland stammenden Sklaven wurden nicht zuletzt für die Arbeit auf den Galeeren eingesetzt, die das Osmanische Reich für seine Expansion benötigte.
Wirkliche Toleranz wird erst mit dem Humanismus zum Ideal, das die Kirche später übernimmt. Das begründet freilich nicht den Umkehrschluss, nach dem der Humanismus einer repressiven Praxis immer entgegengestanden hätte. Selbst ein Bücherfreund der Renaissance wie Don Antonio del Corro (gest. 1556) brachte es fertig, in seinem Hauptberuf als Inquisitor Menschen zu peinigen und zu vernichten. Das düstere Bild, das das Christentum jener Zeit bietet, wird immerhin dadurch etwas aufgehellt, dass die spanische Inquisition, die im 15. Jahrhundert gegen rekonvertierte Juden gegründet worden war, ihre grössten Widersacher in Priestern fand, die ihr selbst entstammten.
„Das Christentum‟, urteilt Jan Assmann, „wurde wohl erst im Zeitalter der Säkularisierung, der Aufklärung und der Konkordate so zahm und menschenfreundlich, wie es uns heute in der engagierten Arbeit von kirchlichen Institutionen, die sich unter anderem für eine adäquate Behandlung von Migrantinnen und Migranten und Unterstandslosen einsetzen, begegnet.‟ Im französischen Nantes wurde die Sklaverei noch über die Französische Revolution hinaus betrieben, wenn auch nicht im Namen des Christentums. Das Ende der Sklaverei war dennoch eingeläutet. Gegen diese hatte sich schon der Marquis de Lafayette entschieden ausgesprochen, der Verfasser der von der Constituante im August 1789 verabschiedeten Menschen- und Bürgerrechtserklärung.
Der schottische Moralphilosoph Adam Smith dagegen hielt die Sklaverei nicht nur für unmoralisch, sondern ebenso für nutzlos. Nach Frankreich und Grossbritannien brach auch die arabisch-islamische Welt mit dieser unmenschlichen Praxis, wenngleich erst im späten 19. Jahrhundert und unter westlichem Druck. Eine innerislamische Kritik an der Sklavenhaltung gab es jedoch schon länger, nämlich spätestens seit dem 16. Jahrhundert. Bis dahin hatte der Islam die Praxis der Antike fortgeführt und sie soweit humanisiert, dass der Sklave nicht als blosse Ware betrachtet wurde, sondern als Mensch mit gewissen Rechten galt. Ohne die expansive Politik hätte es einen Zugriff auf Minderheiten und ihre Verfügbarmachung für die Sklaverei jedoch gar nicht erst gegeben.
Im Islam ist diese Expansion mit einem älteren asketischen Ideal verbunden, das im Konzept des Dschihad eine neue Ausdrucksform fand, die den Tod des Kriegers nicht länger zu einem Sakrileg und Ausnahmezustand erklärte.x Seit seiner Entstehung war der Islam von politischen Schachzügen gegen die mekkanischen Heiden begleitet worden, die Muḥammad selbst initiiert hatte und die später dazu führten, ein Reich zu schaffen, das sich weit über die Arabische Halbinsel hinaus erstrecken sollte. Die Expansionspolitik, die das möglich machte, war mehr als eine blosse Unterwerfungsmission, sondern verdankt sich ebenso der Tatsache, dass Menschen dem Islam zuliefen, weil sie sich einen Vorteil davon versprachen (z.B. bei der Steuer). Auch die Schwäche vorgefundener Machtkonstellationen machte es den muslimischen Eroberern mitunter leicht.
Die glorifizierte Erinnerung an diese Eroberung und Ausbreitung ist jederzeit im Rahmen einer politischen Theologie abrufbar, die leicht an den Erfolgen vergangener Tage anknüpfen weiss. Inwieweit dieser Eroberungsdrang Parallelen in anderen kulturellen Kontexten findet, ist strittig. Für einen Cicero (gest. 43 v. Chr.) wäre der Dschihad in seiner militanten Form nicht in die Kategorie des gerechten Krieges gefallen, weil dafür die entscheidenden Motive fehlen, nämlich Feindesabwehr oder Rache. Dass die Römer selbst fast ausschliesslich Angriffskriege führten, wie schon Machiavelli bemerkte, steht auf einem anderen Blatt.xii Gewiss gibt es ähnliches im Christentum, aber nicht soweit es die Rolle der Stifterfigur betrifft. Der militante Dschihad jedenfalls, der dem koranischen, schon in vorislamischer Zeit benutzten Begriff qitāl („Kampf‟) entspricht, wird „um der Sache Gottes willen‟ (fī sabīl Allāh) geführt und dient nicht einfach der Verteidigung.
Vielmehr ist das Konzept des Dschihad eingebettet in eine Weltsicht, die Gläubige und Ungläubige in ein streng antagonistisches Verhältnis setzt. Dies zeigt sich z.B. an Sure 5,32, in der davon die Rede ist, dass einen Menschen zu töten so verwerflich sei, wie alle Menschen zu töten, und ein Leben zu bewahren so kostbar wie das aller Menschen zu bewahren. Dass dieser Vers als Beleg für ein allgemeines Tötungsverbot im Islam herangezogen wird, ist Tilman Nagel zufolge aber nichts weiter als „Desinformation‟: Aus dem Kontext nämlich ergibt sich, dass es in diesem Vers um die Blutrache geht, die für die muslimische Urgemeinde ausserhalb Medinas eine Gefahr darstellte.
Dass der Dschihad von Anfang im Rahmen kriegerischer Expansion verstanden wurde, zeigt auch die Muḥammad zugeschriebene Überlieferung, nach der er selbst vor einem Niedergang der Gemeinde durch Trägheit und Sesshaftigkeit gewarnt haben soll, wörtlich: „durch das Buch und durch die Milch‟. Gefragt, was er damit meine, habe er geantwortet: „Die Menschen werden den Koran in einer Weise lernen und interpretieren, die anders ist als die von Gott offenbarte.‟ Die Vermutung liegt nahe, dass sich dies gegen das Erlahmen des Expansionsstrebens richtet, doch könnte dahinter auch ein gnostisches Motiv der Weltablehnung stecken. Interessant ist, dass Muḥammad den „Dschihad für die Sache Gottes‟ (ǧihād fī sabīl Allāh) als eine Form des Mönchtums bezeichnet, was sich nur vor dem Hintergrund endzeitlicher, christlich induzierter Erwartungen verstehen lässt, in die er hineinwirkte.
Im Islam wird der Dschihad heute meist als Doppelkonzept einer Überwindung innerer Trägheit („grosser Dschihad‟) und eines äusseren Kampfes gegen die Feinde des Islam („kleiner Dschihad‟) verstanden. Tatsächlich ist ein solches Doppelkonzept, wie Nagel hervorhebt, der klassischen Schariawissenschaft unbekannt, da es auf ein im 11. Jahrhundert fabriziertes Hadith (Prophetenwort) zurückgeht, von dem in den autoritativen Texten des Islams jede Spur fehlt. Der späteren Popularität des sog. „grossen Dschihad‟ hat dies jedoch keinen Abbruch getan und so findet man ihn schon im Werk des um 1400 lebenden osmanischen Dichters Tāǧeddīn Aḥmedī. Das Wort von Max Weber, dass die islamische Gemeinschaft innere Konflikte dadurch beseitigte, dass es „die gewaltsame Propaganda der wahren Prophetie‟ zur Pflicht machte, hat dennoch seine Gültigkeit behalten.
Das lässt sich auch am Komplementärbegriff des ribāṭ zeigen, der das Halten eroberter Territorien in der Expansionsphase des Islam meint. Der ribāṭ wurde von Kämpfern ausgeführt, wie wir sie auch aus Byzanz kennen, die dort akritai (ἀκρίται, Sg. ἀκρίτης) genannt wurden, wörtlich „Grenzkämpfer‟. Denn der Dschihad, wie Weber richtig erkannt hat, gilt nicht in erster Linie Bekehrungszwecken, sondern der Durchsetzung der ǧizya (Kopfsteuer), „bis also der Islam der an sozialem Prestige in dieser Welt Erste gegenüber Tributpflichtigen anderer Religionen sein wird.‟ Dies ergibt nur im Zusammenhang mit militärischer Expansion einen Sinn und darum auch verlief der fast achtzigjährige Eroberungsfeldzug gegen das christliche Sizilien, den der Aġlabiden-Emir Ibrāhīm II. 902 siegreich zu Ende geführt hatte, ganz selbstverständlich unter dem Banner des Dschihad. Krieg gegen den äusseren, nicht-muslimischen Feind zu führen galt noch im Osmanischen Reich als Pflicht, auch wenn dafür der Begriff ġazā (von arab. ġazw oder ġazwa) bevorzugt wurde.
Die Institution des ribāṭ hat offenbar auf das Christentum zurückgewirkt, was der Templerorden nahelegt, der sich im 12. Jahr-hundert in Palästina ansiedelte, um den Zugang zu den heiligen Stätten sicherzustellen. Damals hatten christliche Mächte den Muslimen solange zu schaffen gemacht, bis sich das Blatt wendete und die Mamlūken 1250 einen Dschihad gegen die Kreuzritter ebenso wie gegen die christlichen Reiche der Armenier, Nubier und Äthiopier zu führen begannen. Die Folgen dieser Wende sollten noch lange nachwirken. Seitdem der mamlūkische Sultan Baybars im Jahre 1266 Juden und Christen vom Besuch des Abrahamgrabs in Hebron ausgeschlossen hatte, blieb dieses bis zum Sechstagekrieg 1967 allein den Muslimen zugänglich.
Mehr Toleranz als das christliche Europa zeigte die islamische Welt aber im Umgang mit der im 14. Jahrhundert wütenden Pest: Während das christliche Europa Minderheiten, vor allem die Juden, für ihren Ausbruch verantwortlich machte und messianischer Eifer zu Ausschreitungen führte, wurde im islamischen Kontext die Pest als eine Gnade Gottes gedeutet. Es wurden keine Ansteckungstheorien ersonnen und der millenarische Zorn gegen Andersgläubige blieb aus. Nicht nur deshalb ergibt der islamische Umgang mit Minderheiten ein ambivalentes Bild.
Auch wenn der zweite Kalif ʿUmar viele Juden aus Arabien hatte vertreiben lassen, so war die islamische Herrschaft über Syrien für die örtlichen Juden weniger bedrängend als die des christlichen Byzanz’ oder der Kreuzfahrer. Andererseits liefen Synagogen wie auch Kirchen unter islamischer Herrschaft selbst dort Gefahr, konfisziert zu werden, wo ihre Immunität im Kapitulationsvertrag ausdrücklich festgeschrieben war. Der mit unterschiedlicher Vehemenz durchgesetzte Schutzbefohlenen-Status (ḏimma) für Christen und Juden gewährte Sicherheit, ging jedoch mit diskriminierenden Auflagen einher. Bis zum zwölften Jahrhundert wurde der Bau neuer Kirchen nur gelegentlich geduldet. Andererseits haben islamische Herrscher, wenn es um die Wahrung ihrer Interessen ging, stets mit nicht-islamischen Kräften pragmatisch zusammenzuarbeiten gewusst.
Dennoch wurde allein auf europäischer Seite mit Hugo Grotius (1583-1645) das Konzept des gerechten Krieges (bellum iustum) zwischen den Staaten durch das des bellum solemne ersetzt, das auf die Modalitäten des Krieges abzielte und einen höheren Zweck nicht länger zum Legitimationskriterium erhob. Eine solche Säkularisierung der Kriegführung gab es auf islamischer Seite ebensowenig wie eine Gleichstellung der Minderheiten. Tributäre Abhängigkeit der Andersgläubigen blieb das allgemeine Ziel und offene Diskriminierung die tägliche Praxis. Noch 1785, als der osmanische Admiral Ġāzī Ḥasan Paša Kairo besetzte, war es den Christen untersagt, auf Tieren zu reiten und Muslime als Diener zu beschäftigen. Zwar hatte das Osmanische Reich, das seine zivilisatorischen Standards denen der westlichen Mächte per Reform anzupassen strebte, mit dem Edikt von 1856 (ḫaṭṭ-ı hümāyūn) die Kopfsteuer (ǧizya) für Christen und Juden abgeschafft, diese jedoch durch eine Militärsteuer (bedel-i ʿaskerī) für den nicht geleisteten Wehrdienst ersetzt. Da diese Steuer auch dann gezahlt werden musste, wenn gar keine Rekruten eingezogen wurden, besass auch sie diskriminierenden Charakter. Die Reformregierung hatte darüber hinaus wohl nicht einkalkuliert, dass eine Liberalisierung ihrer Minderheitenpolitik christlichen Missionaren zupass kommen würde, was nicht eben geeignet war, die trübe Stimmung gegenüber den Christen aufzuhellen.
Christen waren unter osmanischer mehr noch als unter arabischer Herrschaft einer feindseligen Politik ausgesetzt. Bereits die osmanische Eroberung Thrakiens im 14. Jahrhundert war mit äusserster Brutalität abgelaufen. Christen wurden getötet, aufgespiesst, auf dem Feuer geröstet, ihre Augen ausgestochen und mit Schein-Kannibalismus eingeschüchtert, wie die Vita eines der osmanischen Anführer, Seyyid ʿAlī Sulṭān, berichtet. Dass das Christentum in Südosteuropa nicht völlig ausstarb, lag einzig daran, dass die osmanische Herrschaft dafür nicht lange genug währte. Der Religionswissenschaftler Philip Jenkins weist darauf hin, dass man in der islamischen Welt zwar immer auch Toleranz gegenüber Christen walten liess, viele christlichen Gemeinden aber letztlich nur dadurch überlebten, dass ihnen die Verfolgung in anderen Regionen einen Zustrom an Glaubensbrüdern verschaffte.
Das jüngere Verständnis vom Dschihad als vornehmlich verinnerlichtes und reaktives Konzept hat ältere Auffassungen nie ganz verdrängen können. So verfocht noch im 19. Jahrhundert ein Gelehrter wie Ḥusayn al-Ǧisr (1845-1909) ein Dschihad-Konzept, das die Mission einschloss, wobei der Missionsgedanke mit ostentativen Verachtung für Minderheiten einherging. Schon im Jahrhundert zuvor hatte ein anderer Gelehrter, Murtaḍā az-Zabīdī, an seiner Zeit kritisiert, dass viele islamische Bräuche verblasst seien, darunter derjenige, nicht als erster den Schutzbefohlenen (ḏimmī) zu grüssen und ihn auch sonst seinen niederen Rang spüren zu lassen.
Heutzutage werden von atheistischer und agnostischer Seite Religionen gerne undifferenziert als menschenfeindliche Ideologien geschmäht, doch haben religiöse Ideale Menschen immer auch dazu inspiriert, sich für die Würde der Schöpfung einzusetzen. Beispiele dafür finden wir schon in der Antike: Als Lukian von Samosata im 2. Jahrhundert n. Chr. die Praxis des Tieropfers anprangerte, tat er dies mit einem Verweis auf die Götter, die wohl kaum Freude über ein rituell erstochenes und qualvoll verendendes Tier empfinden würden. Noch grausamer als das Tieropfer freilich war das Menschenopfer, das abgeschafft zu haben Theophrast zu recht den Juden zuschrieb. Nach Gen. 22,1-24 hat Abraham anstelle der verlangten Opferung seines Sohnes Isaak (ʿaqedat Yiṣḥaq) nur eine „Scheinopferung‟ durchgeführt, wie Hermann Cohen es nannte. Auch die Passage, in der die Verführung zum Götzendienst mit grausamen Strafen belegt wird (vgl. Dt. 13,2-10), ist im Ergebnis die Übertragung eines ursprünglich assyrischen Loyalitätseides auf den Gott des Judentums und damit eine Aufkündigung der Loyalität gegenüber dem assyrischen König.
Manche Legitimation religiöser Toleranz bediente sich mitunter spitzfindiger Argumente. So wurde die Verfolgung von Juden für unchristlich erklärt, da ihre Bekehrung unmöglich gemacht werde, und Thomas von Aquin hielt eine Duldung des Judentums deshalb für angebracht, weil dessen Existenz die christliche Lehre bestätige. Ganz nüchtern argumentierte hingegen Papst Gregor d.Gr. (6. Jahrhundert), der die Verschonung des Judentums schlicht als Gebot christlicher Barmherzigkeit begriff. Religiöse Begründungen von Toleranz gegenüber Andersgläubigen hat es seitdem immer wieder gegeben, auch in der Orthodoxie: Mitte des 18. Jahrhunderts argumentierte der namhafte griechische Gelehrte Eugenios Voulgaris in seinem Traktat über Toleranz, dass der Glaube nur als Ergebnis des freien, ungebeugten Willens zustande komme, der Zwang zum Glauben mithin ein Widerspruch in sich sei.
Dass die Toleranz der Aufklärung auf die Maxime des „Unrecht erleiden ist besser als Unrecht tun‟ zurückgeht, die in der Antike etwa zeitgleich von Sokrates und Demokrit formuliert worden war, ist in der Forschung infrage gestellt worden. So bekräftigt Eric Nelson die ältere These von Georg Jellinek (1895), wonach die Religionsfreiheit gerade nicht gegen die Religion erfochten wurde, wie dies der religions-kritische Diskurs der französischen Aufklärung des 18. Jahrhunderts behauptet. Stattdessen führt Nelson die Toleranzidee auf den Schweizer Theologen Thomas Erastus (d.i. Lüber, 1524-1583) zurück, der eine Vereinigung von Kirche und Staat anstrebte, wobei dem Staat nach dem Vorbild des jüdischen Sanhedrin (Gericht) die Entscheidungsbefugnis zur Beilegung auch religiöser Streitfragen zukommen sollte. Der unter den damaligen Gelehrten populäre politische Hebraismus bildet das Referenzsystem für Konzepte dieser Art.
Allerdings entsprach im 17. Jahrhundert die theologisch begründete Toleranz gegenüber Juden noch keineswegs der politischen Praxis. Die drohende Vertreibung seiner Gemeinde veranlasste noch 1638 den Oberrabbiner von Venedig, Simone Luzzatto, ein „Plädoyer für die Tolerierung des Judentums‟ (Discorso circa il stato de gl’Hebrei) abzugeben. Bemerkenswert ist, dass sich seither die Appelle, Juden als gleichberechtigte Staatsbürger anzuerkennen, in der Regel nicht auf die Religion, sondern auf säkulare Argumente stützten. So spricht sich John Locke in seinem Letter Concerning Toleration [1689] abseits aller Theologie für die freie Religionsausübung von Juden aus, wie auch der Deist John Toland (1670-1722) ganz ähnlich argumentierte. Die Aufklärung und ihre Vorläufer in der frühen Neuzeit machten religiöse Toleranz zu ihrem Markenzeichen. Brutalität wurde mit Rückständigkeit identifiziert, worin sich bis ins 18. Jahrhundert hinein die englische Gesellschaft ihrem Selbstverständnis nach von den amerikanischen Kolonien abgrenzte.
Im christlichen Orient war Toleranz seit dem Vordringen des Islam vor allem eine Frage des Pragmatismus. Bereits 1027 waren im christlichen Konstantinopel für die muslimischen Kaufleute eigens eine Moschee und ein Khan (Unterkunft mit angehängtem Warenhaus) errichtet worden, was ganz im eigenen Interesse lag, verdiente man doch sehr gut an einer doppelten Besteuerung, indem man von jedem Einreisenden ein Siebtel seiner Habe nahm und von jedem Ausreisenden ein Neuntel. Ganz ähnlich wurde auf muslimischer Seite verfahren, als von der vollständigen Islamisierung des Balkans Abstand genommen wurde, um die Kopfsteuer (ǧizya), welche Juden und Christen auferlegt wurde, nicht aufgeben zu müssen. Muslimische (genauer: ḥanafitische) Gelehrte setzten den Mittelmeerhandel in all seinen juristischen Aspekten in islamische Normen um, sodass sie mit dem Rechtssystem jüdischer und italienischer Händler kompatibel wurden.
Natürlich darf man das Thema Toleranz nicht auf Politik und Theologie begrenzen. Im täglichen Miteinander sah die Situation ohnehin häufig sehr viel entspannter aus als offizielle Erlasse dies vermuten liessen. In der islamischen Gestalt des Ḫaḍir (auch: Ḫiḍr, „der Grüne‟), der zuweilen mit dem heiligen Georg der christlichen Mythologie identizifiert wird, fanden Muslime und Christen einen Bezugspunkt gemeinschaftlicher Frömmigkeit und damit gegenseitiger Toleranz. Ähnliches gilt für den heiligen Polykarpos von Smyrna. Der Brauch der griechischen Kirche, die Ikonen lokaler Schutzheiliger in Prozessionen durch die Dörfer zu tragen, fand sogar unter der Beteiligung von Muslimen statt, bis die Obrigkeit dem ganzen ein Ende setzte. Mitunter waren es sogar islamische Geistliche, die Angehörige religiöser Minderheiten vor Verfolgung schützten: Als die Ausschreitungen gegen die Armenier in Kleinasien 1919 auf Ägypten übergriffen, hielten die Scheichs der Azhar-Universität ihre schützende Hand über die Verfolgten und taten, was in ihrer Macht stand, um Angriffe auf Armenier und armenisches Eigentum zu unterbinden.
Kann man Toleranz kulturell verstetigen oder institutionalisieren? Wir werden in unserem Exkurs über die These von der Ambiguitätstoleranz darauf zurückkommen. Heute versuchen manche Gelehrte und Politiker, gegen eine religiös motivierte Gewalt das universelle und völkerverbindende Erbe herauszustellen. Dass Religion immer auch ein friedensförderndes Potential haben mag, entbindet uns jedoch nicht von der Frage, wie sich ein immer noch vorhandenes Aggressionspotential entschärfen und seine Energien auf die Bahnen eines freiheitlichen, pluralistischen und rechtsstaatlichen Gemeinwesens umleiten lassen. Isaiah Berlins Einwand ist ernst zu nehmen, dass man es sich zu einfach mache, religiöse Fanatismen nur von ihrer psychologischen Seite her erklären zu wollen und nicht auch von ihrer intellektuellen.
(Forts. Freitag, 27. Januar 2017)
