Es geht immer noch ein bisschen absurder. Shlomo Sand, ein israelischer Historiker, der durch die These bekannt wurde, dass es ein jüdisches Volk nicht gebe, legt in der NZZ nach. Seine Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen: Das Judentum sei kein Volk, sondern nichts weiter als eine Religionsgemeinschaft, deren Mitglieder in der Geschichte nur durch gemeinsame Riten miteinander verbunden waren. Erst der Staat Israel habe so etwas wie ein Volk geschaffen, jedoch kein jüdisches, sondern ein israelisches. (Forts. des Blogbeitrags vom 04.01.2014)
I.
Sands Argumentation ist abwegig – und das nicht nur, weil die jüdische Tadition seit jeher davon spricht, dass nicht «unsere Vorfahren», sondern «wir» aus Ägypten ausgezogen seien (vgl. Exodus 13,8: «Und du sollst das deinem Sohn an jenem Tage erklären und sagen: …»). Das Judentum ist historisch immer mehr als ein Katalog von Ritualen gewesen; der Philosoph Peter Sloterdijk hat von einem «starken psychischen Engramm» gesprochen, das der Mythos des Exodus erzeugt, womit er für das Judentum konstitutiv bleibt. Natürlich kann man individuell bzw. theologisch anderer Meinung sein. Hier soll uns aber nur die historische Sichtweise interessieren.
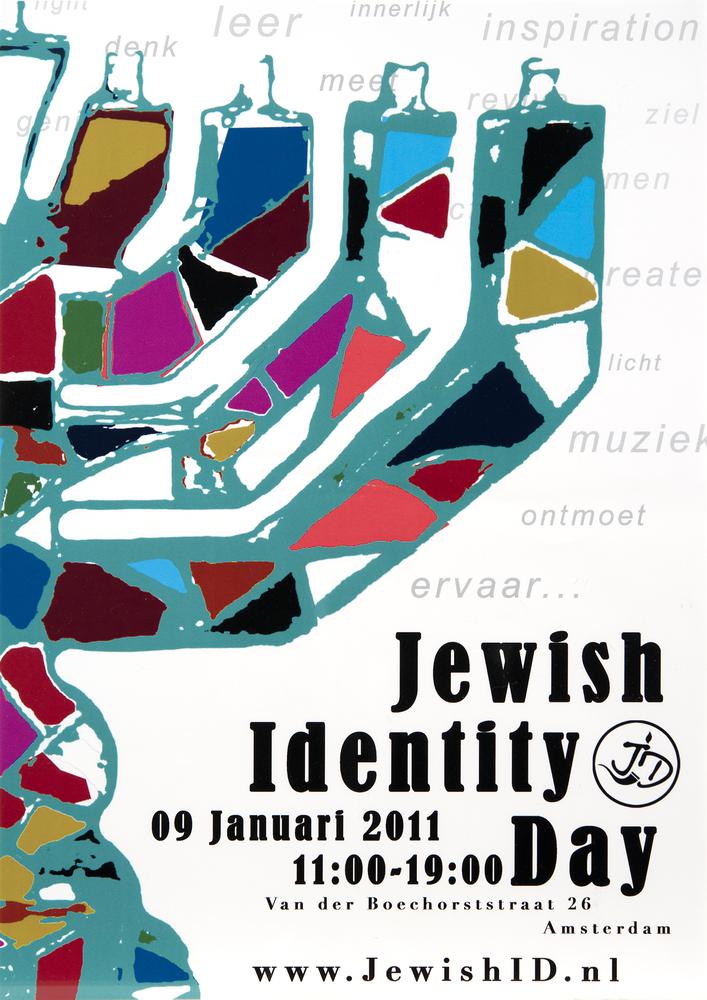
Ein anderer Historiker, Michael A. Meyer, hat darauf hingewiesen, dass viele Konvertiten das Judentum auf eine christliche Weise missverstünden, nämlich als reine Glaubensgemeinschaft, sodass sie ihre Konversion nicht als Schritt betrachten, sich dem jüdischen Volk anzuschliessen. Dies gibt die traditionelle Eigensicht des Judentums wieder, die mindestens so legitim wie die von Sand ist, der das Judentum auf eine Ritualgemeinschaft reduziert. Historisch jedenfalls ist der «deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens» eine neuzeitliche Erscheinung, eine reine Ritualgemeinschaft nie gewesen.
Der entscheidende Punkt aber ist ein ganz anderer, wie sich am Beispiel von Griechenland demonstrieren lässt, das sich für einen Vergleich mit Israel sehr gut eignet. In osmanischer Zeit war eine Rechtsautonomie der Religionsgemeinschaften eingeführt worden, was dazu führte, dass die späteren Nationalismen sich zunächst stärker anhand der Religion, als an irgendeiner säkularen Kultur definierten. Für den griechischen Nationalstaat, der – wie auch Israel und einige andere Länder – auf dem Boden des ehemaligen Osmanischen Reiches entstanden ist, bedeutet dies, dass das Konzept der griechischen Nation eng mit der Religion verbunden sein musste.
Obowohl es ein griechisches Kontinuum gibt, das bis in die Antike reicht, hatte die griechische Nationalbewegung lange nicht gewusst, welches Kriterium die Zugehörigkeit zum griechischen Volk definieren sollte. Die Sprache konnte es nicht sein, denn viele, die sich selbst als Griechen sahen, waren des Griechischen nicht oder kaum mächtig. Das gilt z.B. für viele Vlachen, die es unter den Vorkämpfern der griechischen Befreiungsbewegung gab. (Der bekannteste ist Rhigas, der allerdings Griechisch sprach.)
Folglich wurde die griechische Sprache, die in der Nationalversammlung zu Astros 1823 noch als massgebliches Kriterium genannt worden war, mit dem bürgerlichen Gesetzbuch von Trizina 1827 durch die Formulierung ersetzt, dass jeder Grieche sei, der von väterlicher Seite eine griechische Abstammung aufweise. Diese Regelung entstammt der griechischen Orthodoxie, nach der jeder als Christ gilt, dessen Vater dem Christentum angehört. An anderer Stelle wurde jeder als Grieche definiert, «der die Waffen gegen die osmanische Herrschaft erhebt oder erhob.» Es versteht sich von selbst, dass solche Definitionen problematisch sind. Was war mit denjenigen, die nur von mütterlicher Seite griechischer Abstammung waren? Was mit denen, die Griechisch sprachen, aber nicht gegen die Osmanen kämpften?
Nationalbewegungen, die territoriale Ansprüche aus der Geschichte heraus ableiten, haben meist das Problem, dass sie ihre Nation relativ leicht in diachroner Hinsicht definieren können, aber nur mit Mühe in synchroner Hinsicht. Sie können ein historisches Kontinuum vorweisen, stehen aber vor der Schwierigkeit, genau sagen zu können, wer im einzelnen zur Nation dazugehört oder nicht.
Bis zur Klärung dieser Frage behalf man sich mit Symbolen, die stark identifikatorischen Charakter besassen. Die griechische Nationalbewegung suchte ein antikes Vorbild und fand es im spartanischen Heeresführer Leonidas, der im fünften vorchristlichen Jahrhundert bei den Thermopylen gegen die Perser kämpfte. Die zionistische Bewegung suchte ebenfalls ein antikes Vorbild und fand es im jüdischen Widerständler Simon bar Kochba, der sich gegen die Römer erhob.
Die griechische Nation konnte letztlich, trotz einer langen, bis auf die Antike zurückreichenden Geschichte der griechischen Kultur, nur im Rahmen nationalstaatlicher Strukturen definiert und ausgeformt werden. Die Gründung eines eigenen Staates ermöglichte die Bildung der Massen in griechischer Sprache und die Herausbildung eines griechischen Geschichtsbewusstseins, das nicht auf die Eliten beschränkt war. Damit das Griechische Nationalsprache werden konnte, musste es in einem langen Prozess reformiert werden, um den Anforderungen einer Hochsprache, die auch als Verkehrssprache dienen konnte, zu genügen. Die griechische Sprachenfrage begann im 19. Jahrhundert und endete offiziell erst 1976!

Gegenstand einer Reform im Zuge wurden auch das Hebräische, das Türkische und das Albanische – allesamt Sprachen, die im Laufe der Jahrhunderte eine grosse Kluft zwischen ihrer geschriebenen und ihrer gesprochenen Form ausgebildet hatten. Das Albanische war sogar zwischen zwei Hauptdialekten, dem Gegischen und dem Toskischen, gespalten. Eine Reform des Arabischen wurde debattiert, aber schliesslich verworfen.
Das Hebräische wiederum wurde im Zuge seiner Wiederbelebung als gesprochene Sprache reformiert, aber ganz tot war es zuvor schon nicht gewesen. Von jemenitischen Juden war es noch gesprochen worden, worüber Shlomo Morag (ha-ivrit she-be-pei yehudei teyman, 1963) geforscht hat; ihre Sprachtradition führt über die babylonischen Geonim (talmudische Akademien) auf das Hebräische Palästinas zurück.
II.
Auch die Türkei konnte ihre Nation erst von oben schaffen. Der türkische Unabhängigkeitskampf gegen die Griechen hatte noch stark islamische Züge getragen und war bis zuletzt im Namen von Kalifat und Sultanat geführt worden. Wie wenig selbstverständlich eine nationale türkische Identität noch zu Beginn des 20. Jahrhundert war, zeigt eine Szene aus dem autobiographisch geprägten Roman Yaban (dt. «Der Fremdling») des jungtürkischen Schriftstellers Yakup Kadri Karaosmanoğlu, in der die Begegnung eines jungtürkischer Offiziers mit einigen Bauern in Ostanatolien geschildert wird.
Die Bauern sprachen Türkisch, der Offizier konnte sich mit ihnen verständigen, doch die Idee des Türkentums war ihnen offenbar fremd. Mit Mustafa Kemal konnte sie überhaupt nichts anfangen. Biz Türk değiliz ki, beyim – «Wir sind keine Türken», erklärten sie dem Offizier. Was sie denn dann seien, wollte dieser wissen. Worauf sie ihm entgegneten: Biz İslâmız, elhamdülillâh – «Wir sind Muslime, Herr.» Was Shlomo Sand für ein israelisches Spezifikum hält, ist also eher typisch für die gesamte Region.
Mustafa Kemal Atatürk selbst dachte noch bis mindestens 1919 in Kategorien, die eher religiös als national waren. Die muslimische Bevölkerung Kleinasiens wurde zu dieser Zeit noch als «Türken und Kurden» bezeichnet, um sie von den ebenfalls muslimischen Arabern in den Provinzen abzugrenzen. Später begann man, die kurdische Bevölkerung der türkischen Nation zuzurechnen (und halste sich damit eine Menge Probleme auf). Auch Syrien sieht sich als rein arabischer Staat, trotz einer beträchtlichen kurdischen Minderheit.
In diesem Zusammenhang müssen noch die Vertreibungen erwähnt werden, die jeder der neugegründeten Nationalstaaten vorgenommen hat, sowie die damit einhergehende Homogenisierungspolitik. Dass es heute aber nur eine palästinensische Flüchtlingsfrage gibt und keine griechische oder türkische etc., hängt damit zusammen, dass die arabischen Nachbarstaaten Israels bis heute kein Interesse daran haben, die Palästinenser als gleichberechtigte Bürger bei sich aufzunehmen.
Sonst nämlich könnte die Flüchtlingsfrage schon längst gelöst sein. Griechenland hat selbstverständlich alle griechisch-orthodoxen Flüchtlinge aus Kleinasien aufgenommen, die Türkei alle muslimischen Flüchtlinge aus Griechenland. Juden aus islamischen Ländern, die vielfach ein Dasein als Bürger zweiter Klasse führten, können bis heute nach Israel gehen, das eine grosse Zahl der etwa 800.000 jüdischen Flüchtlinge aus arabischen Ländern aufgenommen hat.
Was die Geschichte angeht, so verfügen Griechenland und Israel über die stärkste Legitimation. Wer meint, Israels historischer Anspruch auf Palästina sei irgendwie konstruiert und künstlich, der schaue einmal nach Albanien, auf die Türkei oder den Libanon. Der albanische Anspruch auf eine Abstammung von den Illyrern der Antike ist fragwürdig; das von Atatürk initiierte Vorhaben, den Türken eine Abstammung von den Sumerern und Hethitern nachzuweisen, Humbug; der noch heute unter libanesischen Maroniten populäre Anspruch, die Libanesen seien die Nachfahren der Phönizier, ahistorisch.
III.
Letztlich unterscheiden sich aber auch die Religionsnationen am Mittelmeer nicht grundsätzlich von den Nationalstaaten westlicher Prägung. Natürlich ist Israel ein Staat für alle seine Bürger, auch wenn er um der jüdischen Nation willen gegründet wurde. Dass ein arabischer Christ oder Muslim sich mit Israel tendentiell weniger identifizieren kann, heisst noch nicht, dass er diskriminiert wird, geschweige denn, dass Israel deswegen ein Apartheidstaat wäre.
Auch die USA sind ein Staat für alle seine Bürger, gleichwohl ist das amerikanische Gründungsnarrativ, das von protestantischen Auswanderern auf der Mayflower handelt, die 1620 an der amerikanischen Ostküste landeten, um eine calvinistische Theokratie zu gründen, nicht dazu angetan, es der indigenen Urbevölkerung leicht zu machen, sich mit ihm zu identifizieren. Ähnliches gilt für Australien, dessen moderne Staatsgründung ebenfalls aus einer britischen Kolonie hervorging und die viel ältere Geschichte der indigenen Bevölkerung ignoriert.
Sind die USA und Australien aber deswegen Apartheidsstaaten? Natürlich nicht. Und auch wenn sich vielleicht nicht alle ihre Bürger mit dem Staat und der Nation sich in gleicher Weise identifizieren können, liegt allein darin auch noch keine Diskriminierung. Für Israel gilt genau dasselbe. Die Behauptung, «[r]ecognizing Israel as a Jewish State is like saying the US is a White State», wie ein «Experte» aus Michigan meint, ist daher nicht nur falsch, sondern grotesk – schon allein deshalb, weil man zum Judentum konvertieren kann, zum Weiss-Sein aber nicht.
Die Forderung gegenüber der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), Israel als jüdischen Staat anzuerkennen, ist auch kein Spezifikum der Regierung Netanjahu, sondern wird in Israel überparteilich akzeptiert: Würde Israel seinen Anspruch aufgeben, ein jüdischer Staat zu sein, müsste es entweder sein Rückkehrgesetz aufheben, das es jedem Juden erlaubt, sich in Israel niederzulassen. Oder es müsste der arabischen Minderheit ein vergleichbares Gesetz zubilligen, was unweigerlich dazu führen würde, dass die Nachfahren all jener im Unabhängigkeitskampf von 1948 vertriebenen Palästinenser nach Israel einwandern.
Es versteht sich von selbst, dass Israel das nicht wollen kann. Die Forderung nach Anerkennung Israels als jüdischer Staat hat denn auch nichts mit Metaphysik zu tun, sondern damit, dass die jüdische Nation nicht zur Minderheit in ihrem eigenen Staat werden will. Wer das nicht versteht oder akzeptiert und immer nur Israel dafür kritisiert, was andernorts als selbstverständlich gilt, kann kein ehrlicher Makler sein, wenn es um den Friedensprozess zwischen Israelis und Palästinensern geht.
