Zweifellos wird am deutschen und überhaupt westlichen Universitäten immer noch Spitzenforschung in Bezug auf den Islam getrieben und gibt es noch immer viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in jahrelanger Kleinarbeit Quellen erschliessen und das Wissen der Menschheit über noch die abwegigsten Aspekte der islamischen Zivilisation um einige Mosaiksteine bereichern.
Seit zehn bis zwanzig Jahren jedoch hat gerade in der universitären Islamwissenschaft eine enorme Ideologierung stattgefunden. Sie zeigt sich immer dort, wo Forschungsergebnisse in einen grösseren Zusammenhang gerückt und die muslimische Welt in einen Bezug zu Europa gesetzt wird. Seit dem einflussreichen Buch Orientalism von Edward Said und dem Aufkommen des Postkolonialismus hat sich eine Apologetik im Fach breitgemacht, die kritische Ansätze gegenüber dem Islam und seiner Geschichte mittlerweile kaum noch erlaubt.

Der Postkolonialismus als Ideologie („postcolonial studies‟) wendet sich gegen eine vermeintliche Wissensproduktion im Dienste eines anhaltenden Kolonialismus, der andere Kulturen unterjochen will, um sie auszubeuten. Man erkennt sofort die marxistischen Wurzeln dieser Ideologe. Said war Antikapitalist, wie auch viele Islamwissenschaftler an den Universitäten, aber zugleich Vertreter eines Dritte-Welt-Nationalismus, der die Islamforscher seiner Zeit dafür kritisierte, eine Linie zu vertreten, die „opposed to native Arab or Islamic nationalism“ sei. Das war freilich nur die erste Phase des Postkolonialismus.
Halbwahrheiten einer akademischen Monokultur
Denn zunehmend werden Bücher geschrieben, die die muslimische Welt nicht nur als verkannte, sondern als überlegene Zivilisation darstellen, der ein rückständiges, intolerantes und gewalttätiges Europa gegenübersteht. Das ist das zwangsläufige Ergebnis einer akademischen Monokultur, die keine richtigen Kontroversen mehr kennt, weil sie andere Meinungen, die vom Said’schen Postkolonialismus abweichen, nichts länger wissen will. Zu den Hauptvertretern dieser Strömung gehören im deutschsprachigen Raum Thomas Bauer (Münster) und Frank Griffel (Yale).
Thomas Bauer hat mit seinem Buch Die Kultur der Ambiguität (2011), ein überaus manipulatives Pamphlet vorgelegt, das von Halbwahrheiten nur so wimmelt (s. dazu meine detaillierte Kritik mit umfangreichen Quellenangaben in meinem Buch Zwischen Religion und Politik), gleichwohl mit dem Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis, dem wichtigsten deutschen Forschungsförderpreis, ausgezeichnet wurde.
Darin weist Bauer zwar ganz richtig darauf hin, dass moralische Grundsätze der islamischen Religion nicht immer auch die der Gesellschaft waren, die sich durchaus über vieles hinweggesetzt hat, was die Religion vorschreibt oder verbietet. Zugleich betreibt er aber eine Theologisierung des Christentums, wenn er die Zustände im „westlichen Christentum‟ auf „radikalste Leib- und Sexfeindlichkeit‟ reduziert.
Indem er von der Kirche auf die Gesellschaft schliesst, macht Bauer genau das, was er dem Westen in Bezug auf den Islam vorwirft. Dabei hat es selbst in der als prüde verschrienen englischen Gesellschaft des 18. Jahrhunderts waren Gesetz und soziale Praxis durchaus verschiedene Dinge. „At one and the same time,‟ konstatiert die Historikerin Linda Colley, „separate sexual spheres were being increasingly prescribed in theory, yet increasingly broken through in practice.‟
Bauer hat jüngst mit einem Buch unter dem Titel Warum es kein islamisches Mittelalter gab (2018) nachgelegt, in der das Mittelalter generell als unglückliche Konstruktion erscheint. Bauer ist dabei wieder ganz auf den arabischen Kulturraum fokussiert, was von den üblichen Rezensenten sonst immer moniert wird, hier aber durchgeht, weil es dem vorherrschenden postkolonialistischen Weltbild an deutschen Universitäten nützlich ist.
Dass das Mitetlalter eine problematische Kategorie ist, ist keine neue Kritik. Wir finden sie z.B. bei dem schweizerischen Philologen und Althistoriker Heinrich Gelzer 1897. Auch hätte Bauer sich, bevor er aus seinen Beobachtungen umfangreiche Schlussfolgerungen zieht, darüber informieren können, woher das Dreierschema stammt, nämlich aus dem Humanismus, der sich an literarisch-philologischen Kriterien orientierte, nicht an politischen, wirtschaftlichen oder sozialen.
Aus Sicht der Humanisten war die Spätantike ein Verfall – ein Zerrbild, das erst mit Johann Gustav Droysen überwunden werden sollte. Der Verfall wurde übrigens nicht den Arabern in die Schuhe geschoben, sondern den Germanen. Schon 1959 konstatierte der Historiker Paul Egon Hübinger, dass das Schlagwort vom „finsteren Mittelalter‟ längst als fragwürdig entlarvt und deshalb ungebräuchlich geworden sei. Zu recht weist er darauf hin, dass Mediävisten sich Darstellungen ihrer Epoche als blosses Verfallssyndrom wenden, weswegen sie lieber von der Transformation der Spätantike sprechen.
Herumspringen in der Geschichte
Neu ist ebenso wenig seine Kritik an der bekannten These des belgischen Historikers Henri Pirenne, wonach nicht die Germanen das Mittelalter eingeleitet, sondern die Araber der Antike das Ende bereitet haben. Hierzu hat ebenfalls Hübinger das Nötige gesagt, indem er darauf hinwies, dass die wirtschaftsgeschichtlichen Beobachtungen Pirennes durch die spätere Forschung „weitgehend eingeschränkt worden‟ und ihre Beweiskraft entschwunden seien. „Im Bereich der kausalgenetischen Erklärung kann die These (…) heute als überwunden gelten‟, resümiert Hübinger. Bauers Anliegen ist aber ohnehin ein anderes. Hinter der ganzen Faktenhuberei steht ein ideologisches Interesse, das freilich nicht auf den ersten Blick erkennbar wird.
Denn Bauer manipuliert seine Leserschaft, indem er unter dem Vorwand, die islamische Geschichte aus den Fesseln europäischen Geschichtsbewusstseins zu befreien, die europäische Geschichte an der islamischen misst. So springt er zwischen den Zivilisationen hin und her, nennt Belege für Errungenschaften der arabisch-islamischen Kultur aus einem Jahrhundert, einem anderen Jahrhundert, einem weiteren Jahrhundert – und stellt ihnen die trübe Situation in Europa gegenüber, das in keinem der genannten Jahrhunderte etwas vergleichbares zustande gebracht hat. Deswegen weicht er den Entwicklungen in Westeuropa aus, die seit dem 15./16. Jahrhundert stattgefunden haben.
Tatsächlich hat kein ernstzunehmender Historiker bestritten, dass die arabische Kultur über Jahrhunderte der des lateinischen Europa voraus war. Dieses Verhältnis hat sich freilich ganz entscheidend zu Zeiten der Renaissance und der Reformation in sein Gegenteil verkehrt, was Bauer unter den Tisch zu kehren versucht. Zudem hat er ein falsches Verständnis von der Renaissance, wenn er in ihr lediglich eine Wiederbelebung der Antike sieht (s. mein Buch Zwischen Religion und Politik). Vielmehr spielt die Rezeption Platons aus griechischen Quellen eine Rolle, die über Umwegen eine Fortsetzung in der Bibelkritik findet, was keine Entsprechung im arabisch-islamischen Raum hat, wo der Platonismus einer ohne Platon war.
Bauer aber setzt alles daran, die islamische Kultur als die überlegene darzustellen, die ihre Überlegenheit nur bedauerlicherweise durch das europäische (eigtl. westliche) Vordringen, also durch den westlichen Kolonialismus eingebüsst hat, der zugleich das ist, was Europa zuvörderst charakterisiert. Der Subtext lautet: Eigentlich ist die muslimische Welt noch immer die fortschrittlichere und je eher wir das erkennen, desto eher können wir dazu beitragen, ihr wieder zum alten Glanze zu verhelfen.
Bauer kann sich mittlerweile jede noch so überzogene These leisten. Würde er behaupten, der Mond sei aus grünem Käse und der Kapitalismus schuld daran, würde er sicherlich auch dafür Beifall finden. „Ich meine, dass die Verflachung des Wissens ein global anzutreffendes Phänomen ist. Wissen wird heute oft durch Meinung, Information durch Skandalisierung ersetzt‟, erklärt er unbekümmert im Interview mit der „Zeit‟. Nicht global, sondern sehr deutsch ist jedenfalls der Kulturpessismus, der hier zum Ausdruck kommt und der in Deutschland eine lange Tradition hat.
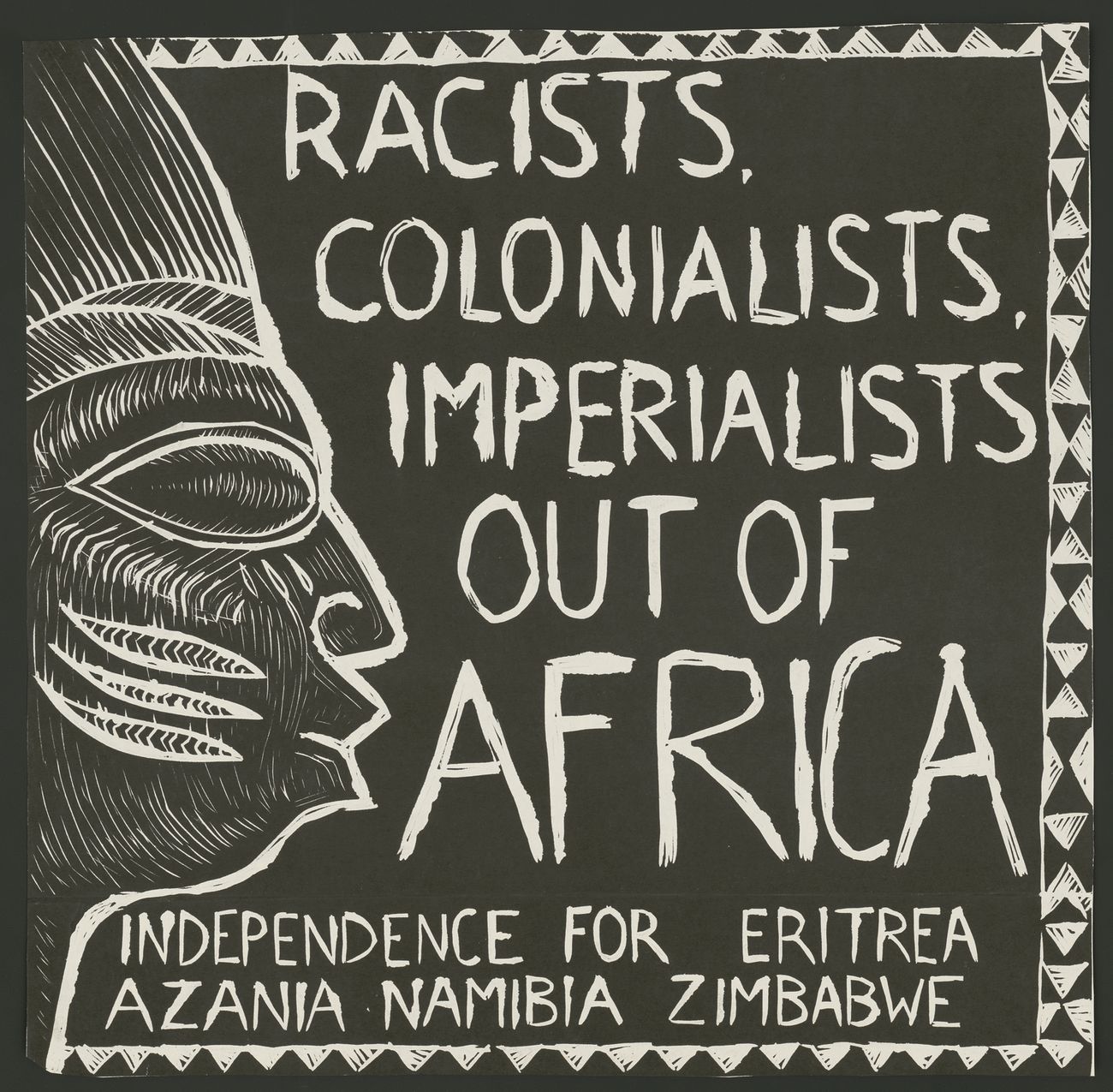
Aus demselben Holz wie Bauer ist auch Frank Griffel geschnitzt, der in seinem Essay Den Islam denken (2019), das allerdings wesentlich schlichter gestrickt ist als Bauers Pamphlet, ebenfalls das Narrativ von einer missverstandenen islamischen Kultur präsentiert, die nicht nur anders, sondern in gewisser Weise besser als die europäische ist. Auch ihm fallen zu Europa immer nur Dinge ein, die in der Zeit vor dem 15./16. Jahrhundert geschahen. Eine Ausnahme bilden bei ihm die europäischen Religionskriege des 17. Jahrhunderts, die kein Pendant in der muslimischen Welt haben.
Wer braucht Fortschritt?
Damit hat er zweifelsohne recht, schmiedet daraus aber ein merkwürdiges Argument für den Islam: Dieser nämlich habe auf gesellschaftlicher Ebene kein Bewusstsein für Fortschritt entwickelt, was Griffel nun aber nicht als Mangel sieht, sondern als eine vortreffliche Eigenschaft, die allzu blutige Schlachten wie in Europa verhindert hat. Der Islam, schreibt Griffel, habe sich ab ca. 1100 den „Kriterien von stetigem Fortschritt und Aufschwung‟ widersetzt und seither nur verändert.
Griffel ist so sehr in seinen Islam vernarrt, dass ihm kein Licht aufgeht, was seine Behauptung in letzter Konsequenz bedeutet: Wo es keinen Fortschritt gibt, finden Neuerungen auf dem Gebiet der Technik oder der Literatur auch keine Anerkennung, wird Kreativität von der Gesellschaft nicht honoriert und bleibt Wohlstand aus und werden individuelle Lebenswege unterdrückt – also genau das, was die muslimische Welt seit eh und je plagt. Griffel freilich hat leicht reden. Er sitzt in Yale, was kümmert es ihn, wer den Computer und die dazugehörige Software erfunden hat, mit der er seine Schwärmereien in Worte fasst?
Fortschritt ist etwas für uns, die anderen können auch ohne ihn auskommen. Es ist reiner Paternalismus, was Griffel hier über aussereuropäische Gesellschaften zum Besten gibt. Ein Fernsehspiel von 1990 nimmt er zum Anlass, über die Ursachen der Flüchtlingsströme nach Europa nachzudenken. Die Afrikaner, so glaubt er, hätten „das Vertrauen in die Entwicklungshilfe verloren‟ und kämen nicht etwas deshalb nach Europa, um hier ein besseres Leben zu führen, sondern „um den Europäern vor Augen zu führen, wie sehr sie von der existierenden Weltordnung profitieren.‟
Afrikaner verlassen also ihre Heimat, geben ihre Freunde, ihr Hab und Gut, ihr ganzes Umfeld auf und machen sich auf eine lange beschwerliche Reise – und das alles nicht deshalb, weil sie anderswo bessere Jobs vermuten und einen höheren Lebensstandard anstreben, sondern allein, um Menschen, die sie nicht kennen und die in einem anderen Kontinent leben, eine Lektion zu erteilen? Woher weiss Griffel das? Ist die Phantasie mit ihm durchgegangen? Egal. Für Griffel ist die Globalisierung die aktuelle Form von Kolonialismus und Postkolonialismus.
Wenn das so ist, wie haben es China, Südkorea, Singapur – um hier nur drei Beispiele zu nennen – geschafft, dermassen wohlhabend zu werden? Auch Korea und China haben die Erfahrung des Imperialismus gemacht, vor allem des japanischen, was vielfach Eingang in die Populärkultur gefunden hat. Mit dem wirtschaftlichen Aufstieg Südkoreas und Chinas hat allerdings auch das nationale Selbstbewusstsein zugenommen, während das autoritäre und rückständige Nordkorea die Rechtfertigung für seinen gesonderten Werdegang mit den Erfahrungen der Kolonialzeit begründet. Südkorea hat gezeigt, dass dieser Werdegang kein unausweichlicher war.
Dessen ungeachtet behauptet Griffel einfach drauflos, es sei damals wie heute unklar, wie die Ungleichheit zwischen der entwickelten und der weniger entwickelten Welt verringert werden könnte. Dass Wohlstand kein Nullsummenspiel ist, sondern geschaffen wird, ist ein Gedanke, der Griffel völlig fremd ist. Die Bedeutung von Errungenschaften wie Individualismus, unternehmerisches Ethos, Privateigentum, Arbeitsteilung und Freihandel scheinen ihm vollkommen unbekannt zu sein.

Heutzutage lebt ein riesiger Teil der Menschheit in Osteuropa, Asien und Lateinamerika, mittlerweile zunehmend auch in Afrika, in immer besseren Verhältnissen – dank der Globalisierung und das heisst: Mehr Marktwirtschaft in der Welt. Publizisten und Wissenschaftler wie Max Rosen, Steven Pinker, Johann Norberg, Jagdish Bhagwati, Fareed Zakaria oder Björn Lomborg versuchen seit geraumer Zeit, diese Tatsache einer grösseren Öffentlichkeit zu vermitteln. Griffel hingegen glaubt, es gebe keine Lösung für das Problem der Unterentwicklung.
Von der Aufklärung führt bekanntlich nur ein kurzer Weg zur Romantik, fassbar in der «Berührung der Schwelle der Magie» (Hans Blumenberg). Jenseits der Schwelle erwartet den Leser dann ein vom Islam verzückter Griffel. Verzaubert von den Geschichten von Tausendundeiner Nacht, die zu lesen es zwar viel Zeit und Geduld bedürfe, rühmt er Erfahrungen und Einsichten, „die in unserer von Fortschritt und Leistungssteigerung dominierten Gesellschaft vielleicht so nicht möglich sind.‟
Nachdem er Gold über die Häupter der Massen gestreut hatte, liessen sie die Vorhänge niederfallen und die Türen verriegeln, während der Schuhflicker Ma’ruf sich auf einen Teppich setzte, die Hände zusammenschlug und rief: «Es gibt keine Kraft und keine Macht ausser bei Gott. Gut, dass die Islamwissenschaftler das endlich erkannt haben.»
Thomas Bauer. Warum es kein islamisches Mittelalter gab: Das Erbe der Antike und der Orient. München: C.H. Beck, 2018. 175 S., € 22,95.
Frank Griffel. Den Islam denken: Versuch, eine Religion zu verstehen. Ditzingen: Philipp Reclam, 2018. 102 Seiten, € 6,00.
Verwendete Literatur
Bauer, Thomas. Die Kultur der Ambiguität: Eine andere Geschichte des Islams. Berlin: Verlag der Weltreligionen im Insel Verlag, 2011.
¶ Weitere Einwände samt Literatur zu den Thesen von Thomas Bauer finden sich in meinem Buch Zwischen Religion und Politik (2016), S. 79-102 (=Exkurs II: Die Freude am Widerspruch), sowie ebd. in den Endnoten S. 283-300.
Blumenberg, Hans. Die Lesbarkeit der Welt. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1981.
Colley, Linda. Britons: Forging the Nation, 1707-1837. New Haven und London: Yale University Press, [1992] 2009.
Geschichten aus Tausendundeiner Nacht. Aus dem Arabischen von Max Henning. Herausgegeben von Johann Christoph Bürgel und Marianne Chenou. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1995.
Hübinger, Paul Egon. Spätantike und frühes Mittelalter: Ein Problem historischer Periodenbildung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1959.
Pirenne, Henri. Mohammed und Karl der Große: Untergang der Antike am Mittelmeer und Aufstieg des germanischen Zeitalters. Mit einem Nachwort von Dan Diner. Frankfurt/Main: Fischer, [1963] 1985.
