„The political future of Germany is largely dependent on her attitude towards Islam.“ (Mohammed Iqbal in einem Brief an Martin Hartmann, 1910)
Zu den Irrtümern der Debatte um einen politischen Islam gehört, dass es nur irgendwie darum gehen müsse, der dschihadistischen Gewalt Herr zu werden und man dafür nur die entsprechenden Passagen des Koran historisch zu lesen brauche. Aber das Problem sitzt tiefer und besteht in einem Mangel an individueller Freiheit, der in den muslimischen Gesellschaften herrscht. Die Unterdrückung individueller Lebensentwürfe führt dann mitunter zur Radikalisierung und Phänomenen wie dem politischen Islam.
Das versteht, wer den Islam nicht in Analogie zum Christentum betrachtet, sondern ein Bewusstsein für die Sozialstrukturen aufweist, die der Islam in seiner Geschichte hervorgebracht hat. Diese Dimension des Islam ist von Soziologen und Vertretern anderer wissenschaftlicher Disziplinen vielfach beschrieben und analysiert worden und sicher ist es kein Zufall, dass die Urheber dieser Forschung fast immer einen muslimischen Familienhintergrund haben.
«Die Kultur hier ist ganz anders. Wir werden so sozialisiert, dass man als Individuum aus der Masse hervorstechen soll. In der arabischen Kultur, besonders in Marokko, bist du Teil einer Familie, einer Gesellschaft, du selbst hast nicht erste Priorität«, musste ein deutscher Auswanderer nach Marokko feststellen. So kann es ergehen, wenn man mit den Gesellschaftsstrukturen anderer Länder konfrontiert wird.
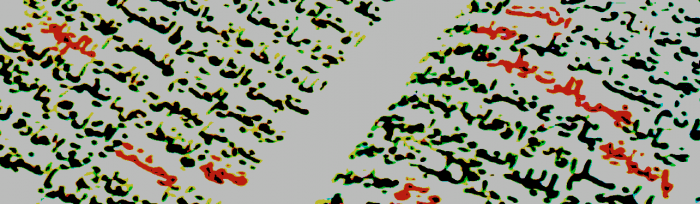
Entsprechende Einstellungen werden schon in der frühkindlichen Erziehung geprägt. Da erst zeigen sich wirkliche kulturelle Unterschiede, nicht in dem, was die Menschen kochen, welche Musik sie hören oder welche Sprache sie sprechen. Natürlich gibt es auch innerhalb von Gesellschaften Unterschiede und brechen manche Menschen auch aus derlei Strukturen aus. Aber im Ganzen besehen sind die muslimischen Kulturen eher kollektivistisch, die westlichen eher individualistisch. Von der muslimischen Moral abweichende Verhaltensweisen oder Neigungen werden, wo möglich, in die Privatsphäre abgedrängt.
Der Historiker Bernard Lewis hat einmal darauf hingewiesen, dass wir allgemein nur sehr wenige Biographien von Individuen aus der Islamischen Welt haben und auch die umfassen meist nur wenige Zeilen oder bestenfalls einige Seiten, während wir auf europäischer Seite Biographien von Bücherlänge haben. Heute ist die Wissenschaft zwar etwas weiter und hat sie sog. Ego-Dokumente verstärkt unter die Lupe genommen, aber ein Unterschied zum lateinischen Europa bleibt bestehen. Das hat Gründe, die tief in die Kulturgeschichte reichen.
Der taklīf als Dreh- und Angelpunkt der islamischen Kulturgeschichte
Anders als manch einer glaubt, ist die sunnitische Rechtslehre nicht von Machtansprüchen der Obrigkeit kontaminiert, sondern, wie der Islamwissenschaftler Norbert Oberauer (Religiöse Verpflichtung im Islam, Würzburg 2004) feststellt, von Gelehrten entwickelt worden, um Normen festzuschreiben, die unabhängig vom Kalifen bestehen und denen auch er sich fügen muss.
Zwar hatte Abbasidenkalif al-Manṣūr (8. Jahrhundert) einen einheitlichen Rechtskodex durchzusetzen versucht, sich jedoch nicht gegen die Gelehrten durchsetzen können, da diese, wie Oberauer schreibt, sein Vorhaben als «Unglaube» (kufr) hätten verurteilen können. Die Kompetenz der Rechtsauslegung verblieb seither in den Händen der Gelehrtenschaft, an der der religiöse Führungsanspruch der Kalifen seine Grenze fand. Einen muslimischen Iustinian sollte es nicht geben.
Kerngedanke der Gelehrtenschaft bildete die Bewahrung des taklīf, d.h. der Verpflichtung des Gläubigen vor Gott. Der taklīf begründet eine ständige Sorge des Gläubigen um sein Seelenheil und wurde, so Oberauer, zum Dreh- und Angelpunkt eines zeitlos gültigen Normengefüges. Die Überzeitlichkeit entspricht ganz der sunnitischen Doktrin von der Unerschaffenheit des Koran.
Wie Oberauer ausführt, war der taklīf ursprünglich als Teil des Glaubens konzipiert. Mit dem Siegeszug des sunnitischen Islam wurde er jedoch Gegenstand der Politik und regelte fortan das gesamte private und öffentliche Leben. Der Gläubige musste sich zwischen Gehorsam und Auflehnung entscheiden, wobei Verstösse im Hier und Jetzt geahndet wurden. Im weiteren Verlauf der Rechtsentwicklung wurde die Bewertung und Überwachung des taklīf durch die Rechtsgelehrten weitgehend monopolisiert.
Der taklīf bindet verschiedenste Aspekte der islamischen Kulturgeschichte, sei es das Gottes- und Menschenbild, ethische Normen oder politisch-soziale Ordnungsvorstellungen. „Wer den Diskurs über die Verpflichtung [taklīf] dominierte, besaß entsprechend auch die Macht, Macht zu legitimieren,‟ so Oberauer. Das religiös-normative Bewusstsein von unten wirkte dann aber auf die Politik von oben zurück, indem der Staat sich seinerseits die Kontrolle des taklīf zu eigen machte.
Halten wir fest: In der islamischen Geschichte ging das Bestreben nach einer an religiösen Grundsätzen orientierten Gesellschaftsordnung von unten aus, wobei die Gelehrtenschaft die massgebliche Triebkraft darstellte und in Distanz zum Kalifen agierte. Dieser gesellschaftliche Zustand entspricht weder dem einer Theokratie, noch ist er säkular. Da religiöse Gesetz, die Scharia, soll über die Gemeinde herrschen, ist aber nicht von einem Herrscher abhängig. Genau darin findet der politische Islam seine Hebelwirkung.
Muslimische Gesellschaften im Schwebezustand
Nicht ohne Grund verfolgen die Muslimbrüder eine sog. «Politik der Stadien» (siyāsat al-marāḥil), wonach ein islamischer Staat sich zwangsläufig einstellen werde, wenn die Masse der Gläubigen nach und nach von unten her dessen Ideale verwirklicht. Dass das nicht nur Wunschdenken ist, sondern auch in der Realität funktioniert, lässt sich leicht daran sehen, dass Vertreter eines politischen Islam bei freien Wahlen durchaus Mehrheiten zu erringen imstande sind. Deswegen sind die muslimischen Gesellschaften auch so zerrissen, befinden sich in einem dauernden Schwebezustand zwischen Säkularismus und politischem Islam, zwischen Demokratie und Despotie.
Es ist falsch zu behaupten, dass Islam und Islamismus bzw. Islam und politischer Islam dasselbe seien. Aber ebenso falsch ist es zu behaupten, beide hätten nichts miteinander zu tun. Vielmehr gibt es eine Schnittmenge zwischen dem politischen Islam und der sunnitischen Orthodoxie. Der gelebte Islam bildet darin oft genug eine Vorstufe zum Islamismus. Wer autoritär im Sinne der Religion erzogen wird, wird später vielleicht ebenso autoritäre politische Ansichten entwickeln und den Staat vor allem in der Rolle des Beschützers der Religion sehen.
Wenn Kinder eine überzogene Strenge des Vaters erfahren, führt dies bei ihnen zur Ausbildung eines intoleranten Über-Ichs, das auf fraglose Unterwerfung und unkritische Gefolgschaft drängt, konstatiert der Psychologe Ahmad Mansour («Generation Allah», 2016). Er spricht von einem salafistischen «Gott-Phantom», das sich in der frühen Kindheit herausbildet. Ein anderer Psychologe, Carlo Strenger («Abenteuer Freiheit», 2017), hat herausgearbeitet, dass die Motivation für Extremisten, unmenschliche Handlungen zu begehen, auf Furcht gründet – und zwar auf Furcht vor der Freiheit.
Da Migranten oft auch ihre Familien- und Sozialstrukturen mitnehmen, kann dies die Aufnahmeländer vor Probleme stellen. Wissenschaftler und Publizisten wie Fatima Mernissi, Sineb el-Masrar, Necla Kelek, Ahmed Toprak u.a. haben diese Problematik im islamischen Kontext vielfach beschrieben und manchen Lösungsvorschlag erarbeitet. Dennoch ist, wenn es um die Prävention gegen den politischen Islam geht, der vorherrschende Ansatz der deutschen Politik nach wie vor der der Akkommodation: Indem man den Vertretern eines konservativen Islam entgegenkommt, so die trügerische Hoffnung, werde schon alles gutgehen.
In der islamischen Geschichte gibt es genügend Beispiele für Toleranz- und Fortschrittsdenken. Doch wurde dies meist von oben herab lanciert und kam der Widerstand dagegen von unten, angeführt von Teilen der orthodoxen Gelehrtenschaft. Wenn der Islam ein wirklicher Teil Europas werden soll, dann muss es gelingen, die islamische Gläubigkeit von ihren kollektivistischen, auf Furcht gegründeten Familien- und Sozialstrukturen, die sie im Laufe der Jahrhunderte hervorgebracht hat, zu befreien. Ein öffentlich und sachlich geführter, kritischer Diskurs über den Islam kann dabei nur gesund sein.
