Ohne Ansehen der Person sollten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Forschungarbeiten ihrer Kollegen berücksichtigen, sofern sie für die eigene Forschung relevant und zugänglich sind. Das ist das wissenschaftliche Ethos, also das Selbstverständnis all derer, die in der Wissenschaft tätig sind, in einen Satz gefasst. Doch im Zeitalter der Dekolonisierung sieht die Wirklichkeit anders aus – mit Konsequenzen für die Politik.

Was also ist das wissenschaftliche Ethos? Da jede Forschungsarbeit das Ziel hat, den vorhandenen Wissensschatz der Menschheit zu vergrössern, muss erst einmal der Forschungsstand zu demjenigen Gegenstand ermittelt werden, zu dem geforscht werden soll. Daraus ergibt sich, dass das wissenschaftliche Publikationen allein auf Grundlage ihrer Relevanz und Zugänglichkeit für die eigene Forschung zu berücksichtigen sind.
Zugänglichkeit bedeutet: Ein Artikel oder eine Quelle kann schwer zu beschaffen sein oder in einer Sprache verfasst, die ich nicht beherrsche. Das ist im wesentlichen ein Problem in den Geistes-, nicht in den Naturwissenschaften oder in der Medizin. Auch kann es sein, dass ich bei meiner Recherche relevante wissenschaftliche Publikationen schlicht übersehe, was sehr leicht geschehen kann, bedenkt man, dass selbst die Teilgebiete von Teilgebieten einzelner Wissenschaftszweige häufig eine schier unüberschaubare Zahl von Publikationen hervorgebracht haben.
Selbst Verschlagwortung und Volltextsuche, Rezensionen, Kataloge, Peer Reviewing, Evaluationen, Wissenschaftspreise, Tagungen usw., die allesamt geschaffen wurden, um Orientierung im Dschungel wissenschaftlicher Erkenntnis zu bieten, sind keine Garantie dafür, dass für den jeweiligen Forschungsgegenstand relevante Publikationen Berücksichtigung finden. Auch die Theoriebildung, die die Relevanz einer stetig sich ausdehnenden Grundlagenforschung auf plausible Erklärungsansätze spezifischer Problemstellungen zu reduzieren sucht, ist selber nicht vor blinden Flecken in der Wahrnehmung relevanten Wissens gefeit.
Wer gegen das wissenschaftliche Ethos verstösst, schwächt die eigene Forschung
Wo Menschen sind, werden also Fehler gemacht, dennoch gilt der Grundsatz: Relevante und zugängliche Publikationen absichtlich – aus welchem Motiv auch immer – nicht zu berücksichtigen, ist ein Verstoss gegen das wissenschaftliche Ethos, für das nur Fakten zählen und nichts anderes. Wer z.B. allein aus persönlicher Abneigung oder Karriereneid einen anderen Wissenschaftler nicht zitiert, obwohl dessen Vorarbeiten für die eigene Problemstellung relevant sind, schwächt die eigene Forschungsleistung.
Auch, dass eine Publikation in einem Verlag oder einer Zeitschrift von eher geringem Prestige erschienen ist, ist kein Grund, sie zu ignorieren. In den Natur- und Ingenieurwissenschaften, in der Medizin und Mathematik dürfte dies aber eher selten der Fall sein, denn die Forschung, die in diesen Disziplinen generiert wird, ist strikt anwendungsbezogen und relevante Forschungserkenntnisse nicht zu beachten, bedeutet dort, im Wettbewerb der Innovationen den Kürzeren zu ziehen. Die Industrie und der internationale Wettbewerb fungieren hierbei als Korrektiv gegen wissenschaftsunethische Praktiken.
Anders sieht es in den Geisteswissenschaften aus. Hier ist es leider gang und gäbe, die Publikationen von Kolleginnen und Kollegen zu ignorieren, nur weil man sie aus irgendeinem sachfremden Grund nicht schätzt. Der bekannte Orientalist Tilman Nagel wird von vielen Fachkollegen, seitdem er sich in nach seiner Emiritierung rechtspopulistisches Fahrwasser begeben hat, nicht mehr zitiert, was manche mir gegenüber sogar offen zugegeben haben, auch wenn sie damit klar gegen das wissenschaftliche Ethos verstossen.
Das Gegenlager ist nicht unbedingt besser. Über die deutsche Orientalistin Annemarie Schimmel sagte mir einmal jemand: «Diese Nazitante darfst du niemals zitieren!» Nun, selbst wenn Schimmel eine «Nazitante» gewesen wäre, sollte allein die Relevanz ihrer Forschung den Ausschlag darüber geben, ob man sie zitiert oder nicht. Sofern die eigene politische Überzeung, welcher Couleur auch immer, nicht mit der eigenen Forschung vermischt wird, diese also den Prämissen jener folgt, darf daraus kein Argument für Dritte erwachsen, eine Publikation grundsätzlich nicht berücksichtigen zu wollen.
In den Geisteswissenschaften jedoch bleiben Verstösse gegen das wissenschaftliche Ethos wie das Nichtbeachten relevanter Forschungserkenntnisse aus sachfremden Gründen ohne Folgen. Es gibt hier kein externes Korrektiv, das solche Praktiken unterbinden oder wenigstens im Zaum halten würde. Dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht zitiert werden, weil der Autor eines Buches mit ihren politischen Ansichten oder ihrer Herkunft ein Problem hat oder sie konträre Thesen vertreten, ist, wie gesagt, keine Seltenheit.
Am Ende des Tages werden Artikel eingereicht und Bücher veröffentlicht, die all diejenigen Publikationen aussen vor lassen, die nicht ins eigene Weltbild passen oder mit deren Autoren man ihrer Ansichten wegen ein Problem hat – ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hätte. In der Bibliothek stehen alle Bücher nach Themen sortiert brav nebeneinander und geben nach aussen hin keinerlei Eindruck davon, welche Machtverhältnisse ihre Inhalte geprägt haben. Macht bedeutet, darüber zu entscheiden, welche Forschungserkenntnisse Teil des wissenschaftlichen Kanons und welche als heterodox an den Rand gedrängt werden.
Macht hat, wer eine Professur bekleidet und verbeamtet ist. Noch mehr Macht als ein einfacher Professor hat, wer sich zusätzlich Leiterin oder Leiter eines Instituts nennen darf und am meisten Macht hat, wer es schafft, zu bestimmten Themen eine feste Grösse im öffentlichen Diskurs zu werden. Denn alle spielen dieses Machtspiel mit: Die grossen Publikumsverlage, die sich mit Buchvorschlägen vornehmlich an Wissenschaftler wenden, die einen hohen universitären Status geniessen; die Medien, die diese Bücher rezensieren; die Öffentlichkeit, die sie diskutiert.
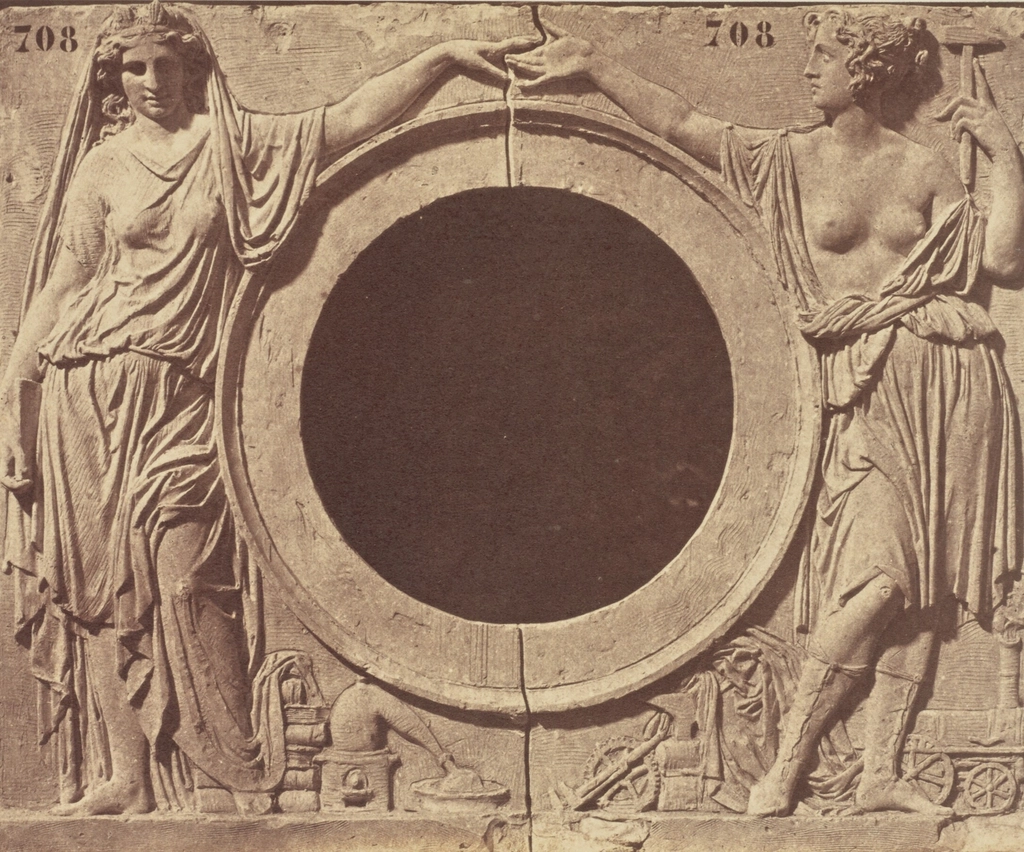
Interne Korrektive, wie etwa Tagungen, auf denen Wissenschaftler ihre Forschungsergebnisse und -thesen vortragen und einer Diskussion von Fachkolleginnen und -kollegen stellen, versagen, wenn es darum geht etablierte Machtgefüge aufzubrechen. Denn zu Tagungen eingeladen werden meist die Grosskopfeten ihres Faches (die dann die sog. Keynote halten dürfen), befreundete Kollegen, und der Nachwuchs aus dem eigenen Stall, dessen aufkeimende Karriere man befördern will.
Ein unbekannter Wissenschaftler mit niedrigem Status und ohne entsprechende Kontakte, mag er auf dem Gebiet, mit dem die Tagung sich befasst, noch so versiert sein, wird es höchstwahrscheinlich nicht auf die Gästeliste schaffen und seine Publikationen, mögen sie noch so relevant sein, wird man in dem zwei oder drei Jahre später veröffentlichten Tagungsband möglicherweise nicht ein einziges Mal zitiert finden. Ob jemand bewusst nicht eingeladen wurde oder man seine Forschungsleistung einfach übersehen hat, wird der Betreffende freilich nie erfahren.
Doch was vorher nur unter vier Augen oder im e-Mail-Austausch zugegeben wurde, dass nämlich oft genug die Zitierfähigkeit an die Person geknüpft wird, wird seit Jahren schon in Forderungen und Selbstverpflichtungen zur «Dekolonisierung des Wissens» gegossen. Die bestehenden Machtverhältnisse sollen derart zementiert werden, dass ungeliebte Forschungserkenntnisse zwar weiter produziert werden dürfen, ihre Sichtbarkeit aber weiter verringert wird.
Die geistige «Dekolonisierung» beruht auf den beiden falschen Prämissen, wonach Europa als ganzes ein koloniales Unternehmen und Kolonialismus zugleich ein rein europäisches Phänomen ist. Tatsächlich gab es europäische Länder, die nie kolonisiert haben und andere, die kolonisiert wurden (so Griechenland von den Osmanen). Dennoch hat sich auf diesen falschen Prämissen eine in den Geisteswissenschaften ubiquitäre Theorie erhoben, die unter dem Schlagwort «Postkolonialismus» Karriere gemacht hat.
Ihre Anhänger verstehen das «Post-» in dem Namen nicht etwa in dem Sinne, dass die gegenwärtige Epoche mit dem Kolonialismus gebrochen hätte, sondern dass dieser von fortwirkendem Einfluss sei, wenngleich nicht von militärischer Eroberung aufrecht erhalten, sondern vermittels entsprechender Denkstrukturen. Dabei wird unterstellt, dass diese Denkstrukturen an die europäische, mithin «weisse» Herkunft gebunden seien – eine Rassentheorie, die vermeintlich herrschende Verhältnisse in ihr Gegenteil verkehrt, anstatt sie zu überwinden.
Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass nicht Fakten eine These konstituieren und nicht im Lichte neuer Erkenntnisse alte Thesen verworfen werden, sondern es nur noch unterschiedliche Perspektiven gibt, die an Hautfarbe und Herkunft gebunden sind. Damit lässt sich dann durchaus Karriere machen. Tamim Ansary, Lektor in einem Schulbuchverlag, hätte nie einen Bestseller über die Islamische Welt landen können, wäre er nicht der Sohn eines afghanischen Vaters
Das genügt mittlerweile, um sich als Islamexperte zu qualifizieren und eine islamische Perspektive zu behaupten, die Ansary in seinem Buch «Die unbekannte Mitte der Welt» (2010; orig. «Destiny Disrupted: A History of the World Through Islamic Eyes») ausbreitet. Soweit sich dies überblicken lässt, hat kein Rezensent weder der amerikanischen noch der deutschen Ausgabe all den Mumpitz bemängelt, den der Autor sich aus den Vorarbeiten weisser westlicher Wissenschaftler zusammengeschustert hat.
Desaströs ist auch der Bestseller des indischen Publizisten Pankaj Mishra. Sein Buch «Aus den Ruinen des Empires» (2013, orig. «From the Ruins of Empire») wimmelt von unhaltbaren Annahmen, aber weil Mishra aus Indien und damit dem «Globalen Süden» stammt, gilt er qua Geburt und Hautfarbe als Experte für asiatische Geschichte. Dass er Primärquellen nur in Übersetzung weisser westlicher Wissenschaftler kennt und sich, wie auch Ansary, aus deren Forschung bedient, scheint abermals keinen Rezensenten zu stören.
Der Aufstieg der Diversität und der Niedergang des Pluralismus
Ein Beispiel aus jüngster Zeit ist das Buch der BBC-Journalistin Zeinab Badawi, die vorgibt, es gebe so etwas wie «An African History of Africa», weswegen ihr gleichnamiges Buch mit den Worten beworben wird, es sei eine «Betrachtung des Kontinents, losgelöst vom eurozentrischen Blick». Wenn man das liest, könnte meinen, die Afrikanistik der letzten Jahrzehnte sei auf dem geistigen Stand tropenhelmtragender Kolonialbeamter und Löwenjäger steckengeblieben. Tatsächlich ist es absurd zu glauben, es gebe so etwas wie eine afrikanische Geschichte Afrikas.
Die gibt es genauso wenig wie eine europäische Geschichte Europas, deren Länder und Regionen sich nicht leicht auf einen Nenner bringen lassen. So waren die meisten Länder Nordeuropas von der aus Italien ihren Lauf nehmenden Renaissance erfasst worden, Deutschland praktisch gar nicht. Die meisten Länder Europas hatten irgendwann gegen ihren Feudaladel gekämpft, Spanien jedoch nicht. In der Malerei haben sich die Niederlande seit dem 15. Jahrhundert zu Höchstleistungen in der Malerei aufgeschwungen, andere wie Portugal hinkten in der Entwicklung hinterher.
Manche Länder, wie Frankreich, waren am Sklavenhandel beteiligt; andere Europäer wurden selber versklavt, darunter die Griechen und Balkanslawen (in Form der verniedlichend als «Knabenlese» bezeichneten osmanischen Praxis der devşirme, christliche Kinder zu entführen und umzuerziehen). Manche Länder Europas waren Kolonisierer, darunter England, Frankreich, Deutschland; andere, wie Serbien oder Rumänien, gehören zu den Kolonisierten der Geschichte.

Umgekehrt wäre der Kolonialismus der Spanier in Südamerika nicht ohne die Hilfe Einheimischer möglich gewesen, die nur zu gern bereit waren, sich gegen ihre aztekischen Unterjocher zu verbünden; ebensowenig wäre die Sklaverei westeuropäischer Länder in Afrika ohne Mitwirkung durch heimische Sklavenjäger durchzuführen gewesen und die Verschickung von Sklaven über das Mittelmeer geschah zum Teil mithilfe einer asiatischen Macht: den Osmanen.
Grundsätzlich sind daher Aussagen über die Geschichte einzelner Kulturen entweder empirisch haltbar – oder sie sind es nicht. Familiäre Wurzeln in der Region zu haben, über die man schreibt, ist nicht immer von Vorteil. Oft genug fehlt es dann an der kritischen Distanz gegenüber dem eigenen Forschungsgegenstand. So wird unter dem Schlagwort der Postcolonial Studies vielfach das historische und kulturelle Selbstverständnis einer heimischen Elite mit höheren akademischen Weihen versehen, was mit Wissenschaft nichts mehr zu tun hat.
Einer der Säulenheiligen der Postcolonial Studies, Edward Said, hat dies ganz offen ausgesprochen, als er westliche Wissenschaftler dafür schalt, dass sie eine Linie vertreten, die «opposed to native Arab or Islamic nationalism» sei.1 Dekolonialisierung wird demnach selektiv verstanden und richtet sich am Ende immer gegen den Westen und vor allem gegen Israel. So hissten nur wenige Tage nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 radikale Studenten an der Universität von Neapel eine Palästina-Flagge.
Dort und an anderen Universitäten des Landes wusste man gleich zu Kriegsbeginn, dass Israel einen Genozid begehen werde. Diese Einstellung lässt sich auch anderswo beobachten und immer sind andere Meinungen nicht erwünscht, wird die wissenschaftliche Kontroverse ausgesetzt. Zwar soll heutzutage alles diversifiziert werden, von der Professorenschaft bis zum Lektürekanon und den Publikationspraktiken, doch zielt «Diversität» allein auf die ethnische Herkunft und geschlechtliche Identität ab, nicht auf einen Pluralismus von Theorien oder Ansichten.
Pluralismus hat im Zeitalter der Dekolonisierung an Wert verloren, denn verstossen Erkenntnisse gegen Glaubensgrundsätze der Postcolonial Studies, wird ihnen keine wesentliche akademische Plattform mehr geboten. Die scientific community wird tribalisiert und das wissenschaftliche Ethos zieht sich zurück in die Siele unabhängiger Publizistik. Zugleich wirkt die Ideologie des Postkolonialismus zunehmend in die Gesellschaft hinein.
Nicht nur auf dem Buchmarkt macht sich das bemerkbar oder in den Feuilletons. Die Stadt New York hat jetzt einen Bürgermeister gewählt, der einem akademischen Milieu entstammt, das genau diese Ideologie feiert, und der die Gesellschaft nach ihren Idealen umkrempeln will. Der Postkolonialismus ist in der Tagespolitik angekommen.
Anmerkungen
- Edward Said. 1994. Culture and Imperialism. London: Vintage, S. 315. ↩︎
